
Wie können wir Gesundheits- und Sozialsysteme besser miteinander verknüpfen? Diese Frage steht im Mittelpunkt des neuen Policy Briefs, den das Schweizer Forum für Integrierte Versorgung (fmc) und Careum gemeinsam erarbeitet haben.
Unsere Gesundheit wird von vielen unterschiedlichen Faktoren beeinflusst, darunter finden sich nicht nur physische, sondern auch soziale Faktoren (finanzielle Herausforderungen, familiäre Probleme, Arbeitslosigkeit etc.). Umgekehrt können sich chronische Erkrankungen oder Mehrfacherkrankungen auf die soziale Situation von Betroffenen auswirken.
Gesundheit und Soziales: Zwei Systeme, die enger zusammenarbeiten müssen
Gesundheit und Krankheit sollten daher ganzheitlich betrachtet werden, indem biologische, psychische und soziale Faktoren gleichermassen berücksichtigt werden. So, wie dies bereits in der Ottawa-Charta der WHO (1986) zum Ausdruck kommt. Folglich benötigen betroffene Patientinnen und Patienten oft nicht nur medizinische, sondern auch soziale Unterstützung.
Doch genau hier gibt es Versorgungslücken, wie zwei einschlägige Papiere – ein Denkstoff des Schweizer Forums für Integrierte Versorgung (fmc) und eine Interviewstudie von Careum – eindrucksvoll belegen. Gesundheits- und Sozialsystem arbeiten noch zu oft in getrennten Strukturen, obwohl eine enge Zusammenarbeit dringend erforderlich wäre.
Fachpersonen im Gesundheitswesen stossen an ihre Grenzen
Die Herausforderungen an der Schnittstelle zwischen Gesundheits- und Sozialsystem nehmen stetig zu. Finanzielle Problemlagen, Schwierigkeiten mit Sozial- und Krankenversicherungen, Arbeitslosigkeit, Mobbing am Arbeitsplatz, Einsamkeit oder schwierige Familienverhältnisse und Wohnsituationen erfordern ein vernetztes Denken und Handeln. Doch bislang gibt es keine klaren Strukturen, Netzwerke und Zuständigkeiten.
Fachpersonen erleben, dass das Gesundheitswesen an seine Grenzen stösst, wenn es um soziale Problemlagen von Patient:innen geht. Zum Beispiel werden Ärztinnen und Ärzte in ihrer Praxis zunehmend mit sozialen Herausforderungen ihrer Patientinnen und Patienten konfrontiert. Allerdings fehlt es ihnen oftmals an Zeit, dem entsprechenden Wissen über verfügbare Angebote und Anlaufstellen sowie den vorhandenen Strukturen, um diesen Herausforderungen adäquat zu begegnen. Während medizinische Überweisungen an Fachärzt:innen oder Therapeut:innen problemlos funktionieren, gibt es kaum standardisierte Prozesse für die Vermittlung an soziale Unterstützungsangebote – ein entscheidendes Manko, das dringend behoben werden muss.
Careum und fmc setzen neue Akzente
Auf Grundlage ihrer Publikationen möchten fmc und Careum gemeinsam neue Akzente setzen. Im Herbst 2024 haben die beiden Organisationen eine interprofessionelle Diskussionsrunde mit Fachpersonen aus Medizin, Pflege, Pharmazie, Spitex, Physiotherapie, Sozialarbeit, Versicherungen und Beratungsstellen veranstaltet. Auch eine betroffene Patientin war mit dabei, um die Herausforderungen an der Schnittstelle von Gesundheit und Sozialem aus ihrer Perspektive zu schildern.
Ein zentrales Ergebnis der Diskussion: Um Menschen mit sozialen Problemlagen in der Grundversorgung optimal zu unterstützen, braucht es ein frühzeitiges Screening sowohl der gesundheitlichen als auch der sozialen Situation. Über Koordinationsstellen und etablierte Netzwerke können dann passgenaue Unterstützungsangebote für Betroffene bereitgestellt werden.
Fünf Empfehlungen für eine integrierte Versorgung von Menschen mit sozialen Problemlagen
Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Diskussionsrunde wurden von Careum und vom fmc in einem Policy Brief zusammengefasst. Er enthält die folgenden fünf konkreten Handlungsempfehlungen, die Politik, Fachorganisationen und Institutionen als Grundlage für nachhaltige Veränderungen nutzen können:
- Gesundheitsfachpersonen sind für soziale Problemlagen zu sensibilisieren und das bio-psycho-soziale Gesundheits- und Krankheitsverständnis ist zu fördern.
- Personen in sozialen Problemlagen sind jeweils in Abhängigkeit vom Schweregrad zu begleiten und zu koordinieren.
- Koordinationsstellen für Personen in komplexen sozialen Problemlagen sind einzurichten, an die aus dem Gesundheitswesen überwiesen werden kann.
- Übersichts- bzw. Netzwerkkarten zu den individuellen Ressourcen und den regionalen Angeboten aus dem Sozial- und Kommunalwesen sind zu erstellen.
- Regionale Kooperationen sind zu initiieren, um eine Koordinationsstelle zu lancieren und bestehende Angebote aus dem Sozial- und Kommunalwesen zu bündeln.
Diese Handlungsempfehlungen werden im Policy Brief erläutert und mit Massnahmen konkretisiert. Sie bieten eine Grundlage für eine nachhaltige und effektive Vernetzung beider Systeme. Die Publikation des Policy Briefs ist ein wichtiger Meilenstein, doch es braucht konkrete Umsetzungsmassnahmen.
Wie geht es weiter?
Jetzt liegt es an politischen Entscheidungsträger:innen, Fachorganisationen und Institutionen, diese Impulse aufzugreifen und umzusetzen. Auch fmc und Careum werden gezielt auf Organisationen zugehen, um die nächsten Schritte anzustossen.
Policy Brief: Jetzt herunterladen
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Den vollständigen Policy Brief können Sie nachfolgend herunterladen:
Download
- Download
Policy Brief zur effektiveren Zusammenarbeit zwischen Gesundheits- und Sozialsystem
pdf (292.89 kB)
Quellen
WHO. (1986). Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung.
fmc. (2022). Besseres Zusammenwirken des Gesundheits- und Sozialsystems – so kann es gelingen. Erfahrungsberichte, Analysen und Handlungsempfehlungen. Schweizer Forum für integrierte Versorgung.
Ulrich, G., Wirth, A., & Flury, C. (2024). Gesundheit und Soziales. Herausforderungen und Chancen sozialer Aspekte im Gesundheitssystem unter besonderer Berücksichtigung interprofessioneller Bildung und Zusammenarbeit. Careum: Zürich. LINK
Diskutieren Sie mit!
- Was sind Ihre Erfahrungen an der Schnittstelle von Gesundheit und Sozialem?
- Welche Handlungsempfehlungen und Massnahmen aus dem Policy Brief sollten als Erstes umgesetzt werden?





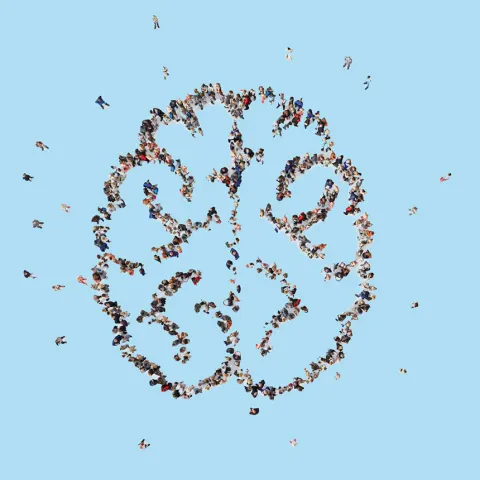

Kommentare