
Vom Prämienschock bis zum Fachkräftemangel: Dr. Peter Berchtold vom College M für Management im Gesundheitswesen zog in einer Careum Impuls-Veranstaltung eine Bilanz aus 40 Jahren im Gesundheitswesen und hob die wachsende Asymmetrie zwischen Behandlung und Betreuung hervor.
Sie sind ein Ärger für alle: Die steigenden Krankenkassenprämien. Doch gleichzeitig profitieren fast alle irgendwo vom System. So das Fazit in den Medien. Doch ist das wirklich auch der Weisheit letzter Schluss? Diese Frage stellte Dr. Peter Berchtold zum Auftakt seines Referats zum Thema «Schweizer Gesundheitsversorgung: Für welches Problem ist der Status quo eine Lösung» in einer Careum Impuls-Veranstaltung in den Raum.
Dominanz der Medizin als Problem
Danach setzte der Mediziner mit langjähriger Führungserfahrung und Mitgründer des College M für Management im Gesundheitswesen zu einer Bilanz nach 40 Jahren im Gesundheitswesen an. Wie sieht sein Fazit aus? Er hob die wachsende Asymmetrie im Kerngeschäft zulasten der Pflege und Grundversorgung und die zunehmende Dominanz der Medizin als Problem hervor. «Alles ist an die medizinische Diagnose geknüpft.» Dies sei nicht etwa der Bosheit der Mediziner geschuldet, sondern folgt aus der Unsicherheit, in der sie ständig leben.
Gleichzeitig wies er auf die Herausforderungen aufgrund der zunehmenden Komplexität der Medizin hin. Die Vielfalt der möglichen Optionen und die Volatilität von Entwicklungen machen das Feld immer breiter. «Was heute gilt, ist morgen vielleicht schon überholt.» Zudem bestehen im Kreuz zwischen Ärzteschaft, Pflegenden, Management und Aufsicht oder im Kreuz zwischen Akutspitälern, Grundversorgung, Krankenversichern und Regulatoren unterschiedliche Perspektiven. «Diese können nicht einfach aufgelöst werden.» Und solche Perspektivenunterschiede mit divergierenden Interessen gleichzusetzen, ist gemäss Peter Berchtold ein bekannter und leider häufiger Kategorienfehler.
Schon Pflegepionierin wies auf Zusammenspiel der Akteure hin
Mit einem Exkurs in die Geschichte der Medizin zeigte Peter Berchtold auf, dass dies nicht unbedingt neue Erkenntnisse sind. Schon die englische Pflegepionierin Florence Nightingale hat vor 160 Jahren auf das Zusammenspiel der Akteure hingewiesen. Sie hielt fest, dass die Patientinnen und Patienten am besten versorgt werden, wenn niemand die Oberhand hat, sondern wenn es eine «fortwährende Reibung» zwischen Medizin, Pflege und Administration gibt. Oder anders ausgedrückt: Wenn die Medizin die Kontrolle hat, führt dies zu Überversorgung, wenn sie bei der Administration liegt zu Unterversorgung und wenn sie bei der Pflege liegt, wird der medizinische Fortschritt eingeschränkt.
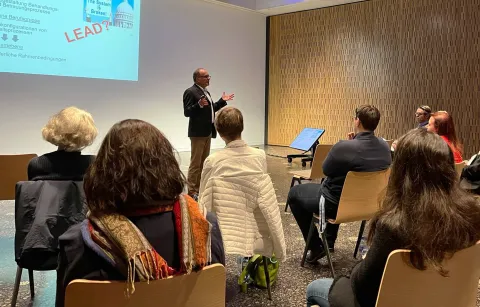
Special Guest im Careum Auditorium: Dr. Peter Berchtold zieht nach 40 Jahren im Gesundheitswesen Bilanz. Bild: Careum
Fachkräftemangel als zusätzliche Komponente
Neu kommt nun noch der Fachkräftemangel als zusätzliche Komponente hinzu, vor allem in der Pflege und Grundversorgung. Die Arbeitszeiten, der Lohn oder die Verantwortung sind gemäss Peter Berchtold nicht allein für den Ausstieg von jungen Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegefachpersonen verantwortlich. «Sie finden offenbar nicht das, was sie erwartet haben.» Er sprach dabei auch von einer Art «Sinnentleerung».
Und was wäre jetzt aus Sicht von Peter Berchtold zu tun? Eine Korrektur der Asymmetrie zwischen Behandlung und Betreuung sah er besonders auf der Ebene der Berufsgruppen. Zum Beispiel in Form von Advanced Practice Nursing in der Grundversorgung und in spezialisierten Bereichen. Auf der Handlungsebene dagegen sei schon viel passiert, etwa mit dem Ausbau der interprofessionellen Kooperation und neuen Zusammenarbeitsformen.
Einfach auf die Systemebene zu hoffen, empfiehlt sich laut Peter Berchtold nicht. «Es deutet nichts darauf hin, dass sich das System top-down ändern lässt.» Es brauche zuerst die Impulse auf anderen Ebenen, bevor förderliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die Pflegeinitiative bezeichnete er in dieser Hinsicht provokativ gesprochen als «Delegation des Problems an den Regulator». Das werde noch einige Jahre dauern, bis neue Regelungen in Verordnungen oder Gesetze gegossen seien.
Auch Pflege muss aufstehen
Im Hinblick auf die Zusammenarbeit auf Augenhöhe, wies Peter Berchtold darauf hin, dass man nicht einfach erwarten könne, dass sich nur die Ärzte von oben herabbewegen müssen, sondern man auch in der Pflege aufstehen oder etwas tun muss, um gleiche Augenhöhe zu erreichen. Ein Patentrezept dafür gebe es allerdings nicht.
Zum Schluss kam in der Diskussionsrunde unter anderem auch die Patientensicht zur Sprache. Ob emanzipierte Patientinnen und Patienten kein Hoffnungsschimmer seien, wollte jemand wissen. Shared Decision Making werde schon lange diskutiert, dämpfte Peter Berchtold etwas die Erwartungen: «Wenn die Leute wirklich mehr mitzudenken beginnen, würde sich das an einem Anstieg der Zweitmeinungen zeigen.»
Diskutieren Sie mit!
- Teilen Sie die Bilanz von Dr. Peter Berchtold?
- Was muss sich Ihrer Meinung nach im Gesundheitswesen verändern? Wo besteht dringender Handlungsbedarf?
- Was ist Ihre Lösung für den Fachkräftemangel?


Kommentare
Gaby Bracher
19.10.2022Ich teile die Einschätzung, dass alles an die medizinische Diagnose geknüpft ist. Dies scheint mir im Vergütungssystem der DRG's auch nicht überraschend. Auch die Prämienerhöhungen scheinen nicht zu überraschen, da spätestens seit Einführung der DRG's klar der Grundsatz "ambulant vor stationär" verfolgt wird. Die Vergütung aus den unterschiedlichen Töpfen der öffentlichen Hand und der Krankenversicherer scheint mir ein Hauptproblem im Gesundheitssystem zu sein. Solange diese beiden Player daran interessiert sind, dass die Leistungen aus dem jeweilig anderen Topf bezahlt werden, wird sich meiner Meinung nach kaum wesentlich etwas ändern können. Auch fehlt es den pflegerischen (wie vielen medizinisch-therapeutischen) Interventionen nach wie vor an Evidenz. Wenn deren Wirksamkeit in Frage gestellt wird, treiben wir zwangsläufig die apparative Medizin voran - bezahlt wird, was messbar ist. Gerade in der Betreuung ein fataler Schluss. In Zeiten hochtechnologisierter und hochspezialisierter Spitzenmedizin sollte die Frage nach Angemessenheit mehr Gewicht erhalten. Durch Corona fanden ethische Fragen den Weg auf das gesellschaftspolitische Parkett, die bis anhin allenfalls hinter vorgehaltener Hand gestellt und diskutiert wurden. Ich denke, wir sollten, ja müssen diese Fragen stellen und diskutieren - auch wenn sie brisant und unbequem sind!
Peter Berchtold
20.10.2022Sehr geehrte Frau Bracher, vielen Dank für Ihren Kommentar. Sie sprechen mehere wichtige Themen an: zum einen die unterschiedlichen Finanzierungstöpfe, die in der Tat vieles behindern. Das soll mit EFAS ja auch angegangen werden. Und gleichzeitig denke ich, dass der Effekt von Finanzierungs- und Vergütungsaspekten auf die Leistungserbringenden - auch wenn er vorhanden ist - stark überschätzt wird. Das hiesse ja auch, dass Veränderung nicht (nur) aus diesem Bereich erwartet werden darf. Das andere ist das Evidenz-Thema und ja, es trifft wohl zu, dass wir sehr viele Evidenzlücken haben. Die Biologie ist eben sehr viel komplexer als noch vor nicht allzu langer Zeit gedacht. Und ich würde mir auch als Arzt wünschen, dass mehr Patienten die Frage nach Angemessenheit stellen würden.
Gaby Bracher
23.10.2022Sehr geehrter Herr Berchtold, vielen Dank für Ihre Antwort. Dann drücken wir EFAS mal die Daumen, dass es im parlamentarischen Prozess nicht bis zur Unkenntlichkeit zerpflückt wird und zeitnah echtes Gehör findet. Auch teile ich Ihre Ansicht, dass mit EFAS nicht alle Probleme gelöst sind. Es warten noch zahlreiche Herausforderungen auf die Akteure im Gesundheitswesen, die Politik und letztlich auch auf die Patienten. Es wäre wünschenswert, wenn alle Betroffenen sich aktiv an möglichen Lösungen beteiligen, aufstehen (wie im Artikel schön formuliert) und eine konstruktive Zusammenarbeit anstreben. Uns allen wünsche ich hierbei gutes Gelingen.
Bruno Facci
30.10.2022Florence Nightingale hatte recht: Den Patienten geht es gut, wenn niemand die Oberhand hat. Heute hat die Ökonomie die Überhand. Das zeigt sich darin, dass den Geschäftsleitungen in Spitälern, Kliniken und Heimen jeweils ein CEO vorsteht, der in der Regel eine Wirtschaftsausbildung hinter sich hat. In den achtziger Jahren wurde die Führung dieser Institutionen in der Regel von einem interdisziplinären Gremium geführt, bestehend aus ärztlicher, pflegerischer und betriebswirtschaftlicher Leitung. Mit dem KVG von 1996 wurde diese Form nach und nach aufgegeben, verlangte dieses doch mehr Wettbewerb, Wirtschaftlichkeit und Effizienzsteigerungen, um die Gesundheitskosten zu dämpfen. Das ist bis heute nicht eingetreten. Dass die Pflege aufstehen soll und die Ärzte sich nicht bewegen sollen ist nichts weiter als die immer noch spürbare Arroganz der Arztgilde gegenüber Pflegenden. Und EFAS ist nichts weiter als eine Nebelpetarde. Damit werden keine Kosten gesenkt und keine unnötigen Behandlungen verhindert. Die bestehenden Kosten werden einfach neu verteilt. Für die Kostendämmung gibt es nur eine Lösung: Wir müssen wegkommen von der mit dem KVG gezüchteten Krämerseelen-Mentalität, die den sozialen Auftrag des Gesundheitwesen verdrängt hat.
Peter Berchtold
31.10.2022Sehr geehrter Herr Facci, vielen Dank für Ihren Kommentar. In zwei Punkten stimme ich mit Ihnen überein, nämlich dass Florence Nightingale Recht hatte und dass mit dem KVG eine Ökonomisierung in die Gesundheitsversorgung Einzug hielt ohne nenneswerten Effekt auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz. Als Lösung versuchte ich daher aufzuzeigen, dass wieder Augenhöhe zwischen Pflege, Medizin und Ökonomie hergestellt werden muss und dies über eine Stärkung der Pflege erreicht wird. Dass "sich die Ärzte nicht bewegen sollen" war natürlich nicht gemeint, sondern, dass sich die Arztgilde dann bewegen wird!
Margarete Stepanik
02.11.2022Sehr geehrter Herr Dr Berchtold, Da dieses Thema vor Landesgrenzen ja nicht haltmacht, erlaube auch ich mir eine Frage zu stellen: Sie sprechen davon, dass auch die Pflege aufstehen muss, um auf Augenhöhe mit der Medizin zu kommen. Prinzipiell bin ich ihrer Meinung, dass Veränderung nie nur von einer Seite ausgehen kann. Allerdings ist mir "aufstehen" doch ein wenig zu allgemein formuliert, in welcher Form kann die Pflege sich noch selbst "stärken" um entsprechend zu wachsen? Die Akademisierung scheint nicht das Mittel zur Wahl gewesen zu sein, die Pflegenden sind gebildet wie nie zuvor, eine evidenzbasierte Pflege prinzipiell - mit bereits genannten Einschränkungen durch die Komplexität der Biologie - gegeben, professionell und emanzipiert das Gesamtbild. Selbst die Impulse zur Repositionierung des Patienten in die Mitte allen Tuns gehen, in meiner Wahrnehmung meist von der Pflege aus, welche eine Koexistenz aller beteiligten Berufsgruppen unterstützt und fördert. Ähnlich starke Impulse lassen manch andere Berufsgruppen zum Teil vermissen, wobei dieser Umstand durch unterschiedliche Machtverhältnisse fast unabänderlich erscheint. Ist es da nicht legitim, davon auszugehen, dass ohne entsprechende Unterstützung vom Regulator eine Veränderung ebensowenig stattfinden kann wie ohne Mitarbeit aller Beteiligten?
Peter Berchtold
23.11.2022Sehr geehrte Frau Stepanik, vielen dank für Ihren Kommentar, in dem Sie auf einen zentral wichtigen Punkt hinweisen: trotz der vielen von Ihnen erwähnten Impulsen und Initiativen scheinen sich Position und Rolle der Pflegenden im Versorgungssystem kaum zu verändern. Die Gründe hierfür sind natürlich vielfältig, gleichzeitig aber sicherlich nicht nur durch die bestehenden Machtverhältnisse zu erklären. Die Frage, ob es nicht vermehrte Unterstützung durch den Regulator braucht, würde ich nicht verneinen wollen. Voraussetzung dafür sind in meinen Augen jedoch dezidiertere Vorstellungen zu neuen Rollen der Pflegefackkräfte und zu Massnahmen, um diese zu implementieren. Erst danmn kann der Regulator unterstützend eingreifen.