
Klinische Alarme sind ein sensibles Thema in der Intensivmedizin. Sie dienen dazu, auf kritische Veränderungen im Zustand der Patient:innen hinzuweisen. Gleichzeitig kann ihre häufige und teils irrelevante Auslösung Alarmmüdigkeit, die Alarm Fatigue, verursachen und dadurch die Patientensicherheit beeinträchtigen.
Ein Alarm ist ein akustisches oder optisches Signal, das auf ein abnormales Ereignis bei Patienten oder medizinisch-technischen Geräten hinweist und eine Reaktion des intensivmedizinischen Personals erfordert. Fehlalarme sind Alarme ohne klinische Relevanz, die fälschlicherweise ausgelöst werden. Studien zeigen, dass 72–99 % aller klinischen Alarme Fehlalarme sind (Sendelbach & Funk, 2013).
Warum gibt es so viele Fehlalarme?
Die meisten Fehlalarme treten aufgrund eines schlechten Kontakts von Sensoren auf. Dies führt zu einer schlechten Signalqualität und somit zu vermehrten Fehlmessungen. Durch die Bewegungen von unruhigen Patient:innen entstehen weitere Artefakte. Fehlalarme entstehen entweder durch zu eng eingestellte Alarmgrenzen des Personals oder durch die Verwendung von Standardalarmeinstellungen. Dieses Phänomen wird durch eine hohe Personalfluktuation, mangelnde Schulung des Personals oder die Unkenntnis der Gerätebedienung verstärkt.
Auswirkungen von Fehlalarmen
Laut Christensen haben Fehlalarme negative Auswirkungen auf das intensivmedizinische Personal und auf Patient:innen. Beim Pflegepersonal führen häufige Fehlalarme zu Stress, Frustration und einer verminderten Leistungsfähigkeit. Ständiges Alarmieren führt zu häufigen Unterbrechungen bei den pflegerischen Tätigkeiten und führt zu einem erhöhten Arbeitsaufwand. Die durch Fehlalarme verursachte Reizüberflutung kann zu einer Desensibilisierung führen. In der Folge werden relevante Alarme ignoriert oder zu spät beantwortet.
Für Patient:innen kann die Lärmbelästigung durch Alarme zu Stress oder Schlafstörungen führen und somit die Genesung negativ beeinflussen. Belästigende Fehlalarmierungen können dazu führen, dass Alarme unabsichtlich ignoriert, stummgeschaltet oder deaktiviert werden. Das kann für Patient:innen einer Intensivstation schädliche oder gar tödliche Auswirkungen haben (Christensen et al., 2014).
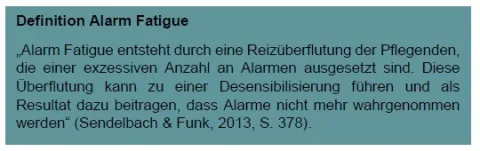
Fehlalarme verhindern – aber wie?
Ein effektives Alarmmanagement auf der Intensivstation erfordert eine Kombination aus institutionellen, gerätespezifischen und personalbezogenen Massnahmen.
Um das Verständnis für die Alarmsysteme zu vertiefen und das korrekte Handling von Alarmen zu gewährleisten, sind institutionelle Massnahmen wie regelmässige Schulungen zur Gerätebedienung und Alarmkonfiguration unerlässlich. Die Alarmeinstellungen müssen regelmässig kritisch hinterfragt und an die jeweilige Patientensituation angepasst werden, um eine angemessene Reaktionszeit zu gewährleisten und die Anzahl an Alarmen zu reduzieren. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist von Bedeutung, um ein angepasstes Alarmmanagement zu entwickeln und kontinuierlich zu verbessern. Pflegende können Alarme vor pflegerischen Eingriffen stumm stellen, um unnötige Warnungen zu vermeiden und sich besser auf die Patientenversorgung zu konzentrieren. Ein täglicher Wechsel der EKG-Elektroden kann beispielsweise dazu beitragen, Fehlalarme zu reduzieren, da so der Hautkontakt der Elektroden gewährleistet ist.
Massnahmen durch die Gerätehersteller können zur Verbesserung des Alarmmanagements beitragen. Der Einsatz von intelligenten Alarmsystemen, die mit Filtern und Algorithmen arbeiten, ermöglicht eine genauere Interpretation der Messwerte und verhindert so eine Überflutung von Fehlalarmen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Überwachungsgeräte führt zu einer Erweiterung der technischen Unterstützungsmöglichkeiten im Umgang mit der Alarm-Fatigue. Durch die Projektion roter Alarme auf die Monitore anderer Patienten sowie auf die Monitorzentrale kann das Pflegepersonal die Alarme analysieren und priorisieren. Das ermöglicht eine gezielte Reaktion auf tatsächliche Notfälle und reduziert unnötige Störungen. Zudem sollten die Geräte benutzerfreundlich gestaltet werden, mit klaren und verständlichen Gebrauchsanweisungen sowie Schulungsmaterialien, um das Pflegepersonal in der Bedienung zu unterstützen.
Massnahmen gegen Fehlalarme
- Regelmässige Analyse der IST-Situation, um Problembereiche zu identifizieren. Patient:innen sollen nur bei Indikation überwacht werden.
- Regelmässige Anpassung der Alarmgrenzen an die individuelle Patientensituation.
- Einsatz von Alarm-Delays zur Verzögerung der Alarmauslösung, um kurzzeitige Grenzwertüberschreitungen zu vermeiden.
- Regelmässige Schulungen des Personals, damit es den Umgang mit dem Überwachungssystem erlernt und das Alarmmanagement der Einrichtung versteht.
- Klare Handlungsanweisungen: Jeder Alarm muss eine Handlung zur Folge haben.
Fazit
Klinische Alarme sind wichtige Bestandteile der Patientenüberwachung auf einer Intensivstation. Ein unzureichendes Alarmmanagement kann die Patientensicherheit gefährden. Durch die Kombination aus technischen Verbesserungen, institutionellen Massnahmen und einem verantwortungsbewussten Umgang des Pflegepersonals mit den
Alarmsystemen lässt sich die Anzahl von Fehlalarmen reduzieren. Ein sinnvolles Alarmmanagement ist entscheidend, um die Patientensicherheit zu gewährleisten und die Belastung für das Pflegepersonal zu reduzieren. Das intensivmedizinische Personal trägt eine grosse Verantwortung, um der Alarm Fatigue entgegenzuwirken. Nur durch eine gezielte und wohlüberlegte Einsetzung von Alarmgrenzen kann auf kritische Ereignisse angemessen reagiert werden.
*Dieser Beitrag entstand im Kurs «Schreibkompetenz» während des Studiums zum Bachelor of Science FH in Nursing an der Careum Hochschule Gesundheit. Die Teilnehmenden wählten ein Thema, mit dem sie in der Regel in ihrem Berufsalltag in Berührung kommen. Die besten Beiträge wurden ausgewählt und für den Blog überarbeitet.
Quellen
Sendelbach, S., & Funk, M. (2013). Alarm Fatigue; A Patient Safety Concern. AACN Advanced Critical Care, 24(4), S. 378-386.
Christensen, M., Dodds, A., Sauer, J., & Watts, N. (Februar 2014). Alarm setting for the critically ill patient: A descriptive pilot survey of nurses' perceptions of current practice in an Australian Regional Critical Care Unit. Intensive and Critical Care Nursing (30), S. 204-210.
Diskutieren Sie mit
• Welche Erfahrungen haben Sie im Umgang mit Fehlalarmen und der Alarm-Fatigue gemacht?
• Welche Strategien nutzen Sie, um Fehlalarme zu reduzieren und der Entwicklung einer Alarm-Fatigue entgegenzuwirken?
• Was können die Arbeitgeber tun, um das Auftreten von Fehlalarmen zu reduzieren?

Kommentare